|
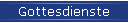
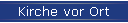

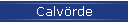
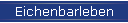

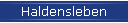

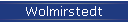
|
1000 JAHRE Christen
in und für WOLMIRSTEDT
Mit Festkonzerten und Gottesdiensten beteiligten
sich die Kirchgemeinden am Festprogramm anlässlich der ersten urkundliche
Erwähnung Wolmirstedts im Jahre 1009. Die Feierlichkeiten in der St.
Josefgemeinde begannen mit einer festlichen Vesper. Im sich anschließenden
Festvortrag zum Stadtjubiläum zeichnete Pfarrer i. R. Peter Zülicke
auf, wie tief die Wurzeln Wolmirstedts im Christlichen verankert sind.
Wurzeln, die heute helfen, die Zukunft dieser Stadt zu gestalten.
Festvortrag zum
Stadtjubiläum
von Pfarrer Peter Zülicke, 19. Juni 2009
Eine Jubiläumsfeier ist der gegebene Anlass, das Leben
heute zu deuten im Lichte der Vergangenheit. So schauen auch die Christen
von Wolmirstedt auf eine tausendjährige Geschichte. Dabei ist festzustellen,
dass sie die einzige Gruppierung von Menschen sind, die in all den Jahrhunderten
hier ununterbrochen in ihrer Glaubensüberzeugung gelebt haben. So können
wir sagen: Wolmirstedt, so wie es sich heute zeigt, ist ohne die Prägung
durch das Christentum nicht denkbar. Das bezeugen die Kirchenbauten,
aber auch die verschiedenen Gemeinden.
Schauen wir auf die Anfänge des
Christentums in dieser Region. Zunächst gibt es ein „Vorspiel“. Im Zuge
der Völkerwanderung waren Sachsen und Franken in unser Gebiet gekommen.
Die Sachsen zogen schon im 6. Jahrhundert weiter. So sorgten die Franken
für eine Besiedlung. Das einzige christliche Zeugnis dieser Zeit steht
uns in unserem Börde-Landkreis ständig vor Augen. Es ist das offizielle
Wappen mit dem Hornhäuser Reiterstein. In der Nähe von Hornhausen bei
Oschersleben gab es wohl ein Kastell der Franken, die Christen waren.
Es sind eigentlich mehrere Steine, die zum Grabmal eines fränkischen
Christen gehörten. An dem zweiten Stein ist auf der dreizipfeligen Fahne
ein Kreuz zu erkennen, das wohl auch auf den anderen Steinen angebracht
war. Es weist auf ein Motiv hin, das im jüdisch-christlichen Raum schon
seit langem gebraucht wurde: ein heiliger Reiter mit Lanze über Schlangen.
Später trat dieses Motiv in der Darstellung des hl. Georg wieder auf.
Dieses Grabmal wurde nach 717 zerstört. Im 8. Jahrhundert finden wir
hier keine christlichen Spuren.
Erst mit dem Zug Karls des Großen an die
Elbe beginnt die endgültige Christianisierung unserer Region. Nachdem
Karl das Gebiet zwischen Harz und Elbe durchzogen hatte und auch hierher
kam, bestimmte er Osterwieck zu einem Missionszentrum. Er vertraute
die Mission einem westfränkischen Bischof an, der schon bald die zentrale
Lage Halberstadts erkannte und nach dorthin zog.
804 kam es zur Gründung des Bistums Halberstadt,
zu dem auch unser Gebiet gehörte. In Magdeburg wurde eine erste Kirche
zu Ehren des hl. Stefanus gebaut. Doch ging es mit der Missionierung
des Volkes nur sehr mühsam voran. Dem zweiten Bischof von Halberstadt
schrieb ein Freund (Hrabanus Maurus aus Fulda): „Mir ist nicht unbekannt,
wie viele Anfeindungen du nicht allein von den benachbarten Heiden ausstehen
musst, sondern auch von der Menge des Volkes, die durch Ungebühr und
raue Sitten dir nicht geringe Mühe bereitet und dir nicht erlaubt, dich
einem häufigen Gebet und eifrigen Studium hinzugeben.“ Wir wissen aber
auch von einem angesehen Christ aus dem Bistum, der 804 in Fulda als
Mönch starb. Die Missionserfolge im Bistum Halberstadt waren also anfangs
noch rech mager.
Das änderte sich erst mit dem Regierungsantritt
Otto I. Dieser König hatte sich als junger Mann vor allem an seinem
Lieblingsort Magdeburg aufgehalten und plante diese Stadt zu einem Zentrum
des Reiches auszubauen. Dazu gehörte auch die Errichtung eines Erzbistums,
dem besonders die Mission der slawischen Völker anvertraut werden sollte.
Nach vielen mühsamen Verhandlungen gelang die Gründung des Erzbistums
im Jahre 968. Es hatte zwar nur ein kleines Territorium, wurde aber
zu einem bedeutenden kirchlichen Mittelpunkt des Heiligen Römischen
Reiches. Da die Ohre die Nordgrenze war, gehörte Wolmirstedt auch weiterhin
zum Bistum Halberstadt. Wir dürfen davon ausgehen, dass Wolmirstedt
schon lange vor seiner Ersterwähnung ein christlicher Ort gewesen ist.
Am Fuße der Burg wurde eine kleine Kirche St. Pankratius errichtet.
Die Verehrung des hl Pankratius ist nach 900 in Deutschland zu beobachten.
Ihm zu Ehren gründete der Graf Lothar 942 in Walbeck ein Stift, 995
wurde die St. Pankratius-Kirche in Nordgermersleben geweiht. Es
ist sicher, dass die Grafenfamilie zu dieser Zeit auch die Pankratiuskirche
in Wolmirstedt erbauen ließ.
Am Beginn des 13. Jahrhunderts breitete
sich in Europa ein Orden aus, der die Erneuerung des Ordenslebens zu
Ziel hatte und dabei segensreich für die Kultivierung vieler Landschaften
wirkte: die Zisterzienser. Die Bischöfe, die zu dieser Zeit in Halberstadt
und Magdeburg regierten, hatten an den großen Universitäten Europas
studiert und dabei auch den neuen Geist dieses Jahrhunderts kennen gelernt.
Sie waren bestrebt, die Zisterzienser auch in ihren Bistümern anzusiedeln.
So wurden in unserer Umgebung mehrere Klöster dieses Ordens gegründet:
1208 Halberstadt, 1221 Magdeburg, St. Lorenz, 1228 Althaldensleben,
1229 Helfta, 1230 Magdeburg, St. Agnes, 1232 Neuendorf, 1259 Egeln.
In die Reihe dieser Klöster reiht sich um 1228 auch Wolmirstedt ein.
Patronin wurde die hl. Katharina – eine Heilige, die durch die Kreuzzüge
im Abendland bekannt und bald auch sehr beliebt wurde. Mittelpunkt des
Klosters wurde die alte St. Pankratiuskirche, die nun St. Katharina
als weitere Patronin erhielt.
Die Kirche diente sowohl der Ortsgemeinde,
wie der Klostergemeinde zum Gottesdienst. Nach den Vorschriften der
Zisterzienser musste die Kirche schmucklos sein. Anstelle eines Turmes
war ein Türmchen auf dem Dach (Dachreiter) erlaubt. Die Glocke rief
die Nonnen zu den sieben Gebetszeiten im Laufe des Tages. Die Klostergebäude,
Kapitelsaal, Speisesaal und Schlafsaal schlossen sich der Kirche an.
Um die materielle Grundlage zu sichern,
wurden dem Kloster von den Bischöfen und Adeligen Land geschenkt, das
zu bebauen war. Einen Hinweis auf das schnelle Aufblühen des Klosters
ist die Notiz, dass schon bald vier Nonnen auszogen, um das Kloster
Medingen bei Uelzen zu gründen. Unscheinbar, wie der Ort im Mittelalter,
ist auch das Kloster geblieben. Nur wenige Nachrichten sind uns überliefert.
Aus dem Jahre 1418 erfahren wir, dass ein Johann von Einbeck, Domherr
in Magdeburg und Propst in Salzwedel einen Altar des hl. Georg, der
hl. Dorothea, der hl. Maria Magdalena und der hl. Drei Könige erneuern
lässt, um regelmäßig dort die hl. Messe lesen zu lassen in bestimmten
Anliegen. Außerdem soll er dem Propst des Klosters im Chordienst und
bei Prozessionen unterstützen.
Am Beginn des 15. Jahrhunderts entstanden,
wie in etlichen anderen Orten, auch in Wolmirstedt Bruderschaften. 1420
stiftete die Elendenbruderschaft in der Kirche einen Altar. Anliegen
dieser Bruderschaft war es, für Fremde und Heimatlose, die in der Stadt
starben, ein christliches Begräbnis zu sichern, für sie zu beten und
hl. Messen lesen zu lassen (deswegen der Altar)
Ebenso war ein Wolmirstedt auch eine Kalandsbruderschaft
gegründet worden. Der Name stammt von dem üblichen Gottesdienst immer
am Monatsersten (Calendae). Es war eine Gemeinschaft aus vornehmeren
Geistlichen und Laien unter dem Vorsitz eines Geistlichen Dechanten
(meistens der Pfarrer von Wolmirstedt). In den zunehmend schwierigen
und unsicheren Zeiten sicherte man sich gegenseitigen Beistand in Einvernehmlichkeit
zu, gewährte Hilfe bei wirtschaftlichen und rechtlichen Schwierigkeiten,
sorgte für ein würdiges Begräbnis und das weitere Gedenken für die Verstorbenen.
Eine besondere Rolle spielten für Wolmirstedt
auch die Erzbischöfe von Magdeburg, obwohl der Ort nicht zu ihrem Bistum
gehörte. Landesherren waren die Askanier und Brandenburger. Die Burg
sicherte einen strategisch wichtigen Punkt am Übergang von Elbe und
Ohre vor allem in der Nord-Süd-Richtung. So gab es viele Kämpfe um die
Burg. Anfang des 14. Jahrhunderts konnten die Erzbischöfe die Burg in
ihren Besitz bringen. Offensichtlich haben sie sich hier gerne aufgehalten,
um dem städtischen Trubel und manchem Unmut der Bevölkerung Magdeburgs
aber auch der Pest zu entfliehen. Wolmirstedt bot eine angenehme, nicht
weit von der Stadt entfernte Sommerresidenz. Hier starb 1361 der Erzbischof
Otto von Hessen, ein Nachkomme der hl. Elisabeth. 120 Jahre später hat
Erzbischof Ernst von Sachsen Wolmirstedt eine Kostbarkeit hinterlassen:
Die spätgotische Schlosskapelle, die eine prächtige Ausmalung aufwies.
Leider ist die Schönheit dieses Raumes nur noch zu erahnen. Der Erzbischof
ließ nach 1500 in Halle ein neues befestigtes Schloss bauen, in dem
er sich dann fast ausschließlich aufhielt.
Bezeichnend für die Zeit war, dass weltliche
Macht für einen Bischof mehr galt, als das geistliche Amt. Im Gerangel
der umliegenden Fürstenhäuser wurde er schon mit elf Jahren zum Erzbischof
von Magdeburg und bald auch zum Bischof von Halberstadt gewählt. Sein
Nachfolger, Kardinal Albrecht von Brandenburg, war als 24 jähriger im
Besitz der Erzbistümer Magdeburg und Mainz sowie des Bistums Halberstadt.
Allein diese Tatsache macht deutlich, dass eine Reform in der Kirche
notwendig war. Daraus erwuchs die Reformation, die zur Spaltung der
abendländischen Christenheit führte.
Auch in diesem Zusammenhang ist Wolmirstedt
zu nennen. Die Stadt Magdeburg war schon sehr früh 1524 nach einer Predigtwoche
Martin Luthers evangelisch geworden und hatte sich in den folgenden
Jahrzehnten den Forderungen des Kaisers nicht gebeugt. Deswegen verhängte
der Kaiser die Reichacht über die Stadt. Das bedeutete, der Stadtrat
war politisch handlungsunfähig. Auch Wolmirstedt wurde in die militärischen
Auseinandersetzungen hineingezogen. Schließlich erkannte der Reichstag
von Augsburg 1555 die Gleichberechtigung der Konfessionen an, legte
aber fest, das ein Reichfürst, wenn er die Konfession wechselte, seine
Ämter verliert. Danach begannen wieder Verhandlungen zwischen dem Erzbischof,
dem Rat der Stadt und den Vertretern des Kaisers. Am 29. Januar 1558
wurde auf dem Wolmirstedter Schloss ein Vertrag geschlossen. Beide Seiten
versicherten einander, entsprechend den Augsburger Beschlüssen auf „ewige
Zeiten“ den Bestand der anderen Religion zu achten. Der Dom, St. Sebastian,
ULF wurden wieder für den katholischen Gottesdienst geöffnet, der von
nun an nicht mehr behindert werden sollte. Entgegen den Bestimmungen
des Wolmirstedter Vertrages gewannen radikale Kräfte in Magdeburg die
Oberhand. Nach wenigen Monaten wurde verboten, „ die papistischen
und abgottischen Messen, Gesänge und Zeremonien allhier im Dom und des
Orts in etlichen Kirchen zu halten und also ein gottlos Wesen
und Gotteslästerungen wieder aufzurichten und hinfür zu treiben.“ Ein
jeder Bürger habe sich solcher Abgötterei zu enthalten.
Der damalige Erzbischof Sigismund trat
1561 zum evangelischen Glauben über, setzte sich aber über die Bestimmungen
des Reichtages hinweg und bestimmte weiterhin das Leben im Erzbistum.
Ebenso tat es sein Nachfolger Joachim Friedrich, der sich nur noch als
Administrator des Erzbistums sah, ohne Weihe aber mit allen Rechten
ausgestattet. Es wurden sogenannte Visitationen angeordnet, um die Besitzverhältnisse
der Klöster und Stifte festzustellen. Der Landesherr wollte deren festes
und bewegliches Eigentum möglichst komplett übernehmen. Gleichzeitig
wurde mit der Visitation auch die konfessionelle Einstellung der Geistlichen
und Nonnen überprüft. Dabei wurden die katholisch gebliebenen unter
Druck gesetzt, um ihren Widerstand gegen die Einführung der Reformation
zu brechen. Dass das ungesetzlich war, interessierte die Landesherren
nicht.
Die Reihe der Visitationen in Wolmirstedter
Kloster begann 1561. Die Nonnen waren in den kriegerischen Wirren zehn
Jahre zuvor nach Stendal geflohen, aber offensichtlich wieder
zurück gekehrt. In dem Bericht werden 16 Schwestern genannt, die ihre
Gelübde abgelegt haben und eine, die sich darauf vorbereitet, acht Laienschwestern
und andere Personen, darunter acht Mägde, drei Wagenknechte, vier Drescher,
ein Schweinemeister, ein Pförtner, ein Futterschneider, ein Stutenhirte,
ein Kuhhirte, ein Schweinehirte, ein alter verlebter Knecht im Ganzen
59 Personen – also ein noch gut funktionierendes Kloster. An Sachwerten
werden aufgezählt: Sieben große Pergament-Mess und Vesperbücher, eine
geschriebene Pergamentbibel in fünf Teilen gebunden, 12 große Papierbücher.
Bei der dritten Visitation unter Joachim
Friedrich wird kurz und knapp festgestellt, dass der Konvent evangelisch
geworden ist. Da heißt es unter Kloster Wolmirstedt: Diese Personen
erkennen die Augsburgische Konfession vor die rechte und wahre Religion,
wollten dabei verharren, halten sich zur Kommunion sub utraque. Damit
war das Kloster als katholische Einrichtung zu seinem Ende gekommen.
Es wurde zunächst noch evangelisch weitergeführt aber 1732 in ein adeliges
Damenstift umgewandelt.
Auch diese Zeit muss eine schwierige
gewesen sein. Es wird berichtet, dass der Große Kurfürst und die ersten
Preußischen Könige gewaltsam in das Klosterleben eingriffen. Von einem
geistlichen Leben war fast nichts mehr zu spüren. Nach der Reformation
hätte die Nonnen nicht verstanden, dass sie eine große sittlich Aufgabe
zu erfüllen hätten, etwa die Jugend der Stadt zu unterweisen, die Mädchen
im Stricken , Nähen u.dergl. zu unterrichten, Krankenpflege üben oder
Kirchengewänder zu sticken. Die Umwandlung in ein adliges Fräuleinstift
konnte der altersschwachen Anstalt kein neues Leben bringen und als
Napoleon kam, war daran nichts mehr zu verderben. 1810 wurde das Stift
aufgelöst. Außer dem sogenanten Äbtissinnenhaus sind keine Gebäude mehr
vorhanden. Der Taufstein und einige Grabsteine aus katholischer Zeit
befinden sich in der jetzigen Katharinenkirche, die auf den Fundamenten
der alten Kirche im 19. jahrhundert errichtet wurde.
Die Konfession der Gemeinde in Wolmirstedt
war nach der Reformation evangelisch. Einige Nachrichten aus dieser
Zeit sind uns erhalten, vor allem in den Visitationsprotokollen. Da
heißt es z.B.: In Wolmirstedt wohnen nur 30 Familien, die aber 200 Beichtkinder
stellen. Die Leute aus Farsleben kommen nach Wolmirstedt zur Kirche.
Schließlich fügt der Pfarrer hinzu, er habe Personen, die für Hexen
gehalten würden, sechs Wochen suspendiert (nicht zur Beichte und hl.
Abendmahl zugelassen). Doch untersagten ihm die Visitatoren, dies ohne
Wissen des Rates weiter zu tun. Sonntags wurde zweimal gepredigt, bisweilen
war nachmittags eine Betstunde nebst Sermon und Katechismusübung
Mittwochs war eine Predigt, aber
oft kämen nur zwei Zuhörer. An den hohen Festen predigte der Pfarrer
fünfmal. Zum Beichtstuhl kämen die Leute halbwegs, zur Kirche sehr unfleißig.
Dann wurden auch die Kirchenväter und Gemeindevertreter gefragt. Sie
beklagten sich, dass der Pfarrer sie gleich Schelme und Diebe nenne,
auch die Leute zusammenhetze. Sonntag nachmittags predige er nicht,
auch nicht in der Woche, obwohl er es sonntags abkündige. Halte er einmal
eine Betstunde, so lese er die Litanei und ein paar Bußpsalmem. Der
Schulmeister predige zuweilen nachmittags.
In der Zeit nach der Reformation
waren alle Bewohner von Wolmirstedt evangelisch geworden. Aber es gab
noch einige Gemeinden in den Klöstern der Umgebung, die trotz drängender
Visitationen den katholischen Glauben behalten hatten. Es waren die
Zisterzienserinnen-Konvente von Magdeburg St. Agnes, Althaldensleben,
Meyendorf bei Wanzleben und Egeln, sowie das Benediktinerkloster in
Ammensleben.
Das Kloster in Ammensleben hatte
sich schon in der Zeit vor der Reformation einer Erneuerungsbewegung,
der Bursfelder Kongregation angeschlossen und eine neue Blütezeit erlebt.
In den Visitationen nach 1561 wurden die Mönche immer mehr bedrängt,
das katholische Bekenntnis aufzugeben. Die meisten von ihnen gerieten
ins Schwanken und wandten sich schließlich der neuen Lehre zu, auch
der Abt. Messopfer, Segnungen und Verehrung der Heiligen wurden abgeschafft,
das Chorgebet aber weiter gepflegt als mit der Reformation vereinbar.
Im Visitationsprotokoll von 1577 heißt es: In diesem Kloster ist es
auch richtig (evangelisch) ausgenommen der Prior und sonst noch drei
Mönche, seint gar verstockte und halsstarrige Papisten. Eine kritische
Situation ergab sich nach dem Todes des Abtes Schuckmann. Der Administrator
Johann Friedrich bestellte einen Verwalter, der sich im Kloster durch
sein räuberisches Auftreten keine Sympathien verschaffen konnte. Durch
Vermittlung der Äbte der Bursfelder Kongregation wurde vereinbart: Der
Verwalter wird nach einer finanzielle Abfindung auf sein Amt verzichten.
Das Kloster wählt einen neuen Abt. Die Wahl fiel auf das jüngste Mitglied
des Konventes den 24 jährigen Ludger Hüffkens, dem in kleinen Schritten
die Durchsetzung der alten Ordnung gelang. 230 Jahre hindurch konnte
sich das Kloster gegen die Willkür der Landesherren behaupten. 1804
löste es der Preußische König auf, um die materiellen Güter dem Staat
einzuverleiben. Die katholische Gemeinde blieb allerdings bestehen.
Die Klosterkirche wurde ihr als Pfarrkirche zugewiesen. Wolmirstedt
wurde später diesem Pfarrbezirk eingegliedert.
In der Zeit des Napoleonischen Königreiches
Westfalen, zu dem unser Gebiet gehörte, wurden zum ersten mal seit der
Reformation um 1811 wieder einige Katholiken in Wolmirstedt verzeichnet.
Die industrielle Entwicklung in der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts
ging allerdings an Wolmirstedt vorbei. So blieb auch die Schar der Katholiken
gering. Durch den Bau der Eisenbahnstrecke Magdeburg-Stendal kamen 1849
einige Katholiken her. Sie gingen nach Ammensleben zum Gottesdienst
oder fuhren mit der Bahn nach Magdeburg.
1856 waren einige Katholiken Wolmirstedts
bei Bischof Konrad Martin in Paderborn vorstellig geworden mit der Bitte
um regelmäßigen Gottesdienst. Daraufhin schrieb der Generalvikar an
den Pfarrer in Ammensleben, für die Anstellung eines eigenen Geistlichen
in Wolmirstedt sei zwar kein Geld vorhanden. Aber man könne in Ammensleben
vielleicht einen Vikar anstellen, der auch nach Wolmirstedt käme. Der
Pfarrer bat um die Einrichtung der Vikarsstelle, hielt es aber für noch
dringlicher, in Wolmirstedt eine Privatschule für die 40 – 50 katholischen
Kinder zu errichten. Der Lehrer könne dann für die Gebrechlichen sonntags
im Schulraum eine Betstunde halten. 1856 sandte nun der Bischof den
Neupriester Theodor Silberg nach Ammensleben mit dem Auftrag für Wolmirstedt.
Dort richtete er im Herbst 1857 eine einklassige katholische Privatschule
mit 36 Kindern ein. Ab 1860 wurde zweimal im Monat die Eucharistie gefeiert
(anfänglich im Hause einer Frau von Dresky). 1864 konnte ein Haus in
der Stendaler Straße gekauft werden, das für die Belange der Gemeinde
umgebaut wurde. Am 18.3.1869 ernannte der Bischof den Neupriester Josef
Dettmer zum ersten Schul- und Missionsvikar in Wolmirstedt. Es zeigte
sich bald, dass er den Anforderungen gesundheitlich nicht gewachsen
war. Nach einem Jahr musste er die Stelle wieder verlassen. Es wurde
1870 ein Nachfolger ernannt, bei dem sich nach acht Jahren Zeichen
von Geistesgestörtheit zeigten, so dass er versetzt werden musste.
Es war die Zeit des Kulturkampfes,
in der keine Priester geweiht werden konnten. So erhielt Wolmirstedt
zunächst nur einen Lehrer, der den Schulbetrieb fortsetzte. Die Gottesdienste
wurden von Ammensleben aus gehalten.
1935 konnte das jetzige Grundstück erworben werden. Ein Jahr später
wurde die Kirche eingeweiht und Wolmirstedt als eigene Seelsorgestelle
gegründet.
Die vergangenen Jahrzehnte sind den älteren unter uns noch in deutlicher
Erinnerung. Aus der Chronik ist ersichtlich, dass es schon länger gute
ökumenische Beziehungen gegeben hat.
Wenn wir zurückschauen wird deutlich,
dass in den tausend Jahren Christen immer eine wichtige Rolle in dieser
Stadt gespielt haben. Sie waren nicht nur da, sondern haben die Stadt
auch mit Leben erfüllt. Viele Entscheidungen wurden von christlichen
Grundsätzen getragen.
In den letzten Jahrzehnten hat sich das grundlegend verändert. Christen
sind in dieser Stadt eine Minderheit, die nicht immer deutlich genug
wahrgenommen wird. Aber wir sind ja nicht nur i n dieser Stadt, sondern
f ü r diese Stadt da. Das zeigt sich im äußeren Erscheinungsbild
vor allem in den diakonischen Einrichtungen. Das Bodelschwing-Haus mit
seinen Nebeneinrichtungen spielt eine wichtige Rolle, ebenso das Don-Bosco-Heim
der Caritas. Ich denke auch an kirchenmusikalische Veranstaltungen und
andere Angebote für alle Bewohner dieser Stadt.
Vor allem erscheint mir aber wichtig, dass die Christen dieser Stadt
in ihren Gottesdiensten nicht nur für sich da sind, sondern gleichsam
alle Menschen hier mitnehmen und in ihr Gebet einschließen. Stellvertretend
für alle vor Gott treten - das gehört zu unserem Tun für die Menschen
in dieser Stadt. So dürfen wir mit allen, die in diesen Tagen
hier zusammen sind, in großer Dankbarkeit und Freude das tausendjährige
Jubiläum feiern und auch weiterhin erfahren: Gott ist mit
und in dieser Stadt.
|
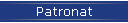
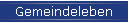
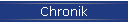

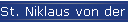
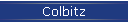
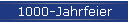
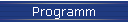
|